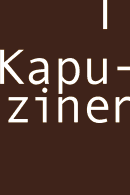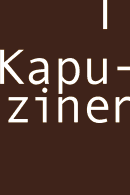|
Evangelium
Der Zöllner ging gerechtfertigt
nach Hause zurück, der Pharisäer nicht
+
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas
In jener Zeit
9erzählte
Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die
anderen verachteten, dieses Gleichnis:
10Zwei
Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der
andere ein Zöllner.
11Der
Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke
dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger,
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort.
12Ich
faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens.
13Der
Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum
Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir
Sünder gnädig!
14Ich
sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn
wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird
erhöht werden.
Es gibt Worte, die zentrale Themen
unseres christlichen Glaubens ansprechen und doch in der kirchlichen Praxis kaum
eine Rolle spielen. Früher waren sie einmal wichtig, es war von ihnen oft die
Rede. Vielleicht zu viel und zu oft! Doch heute führen sie ein Schattendasein.
Es ist, als wären sie aus der Mode gekommen. Das Wort „Sünde“ gehört meines
Erachtens dazu.
In Katechese und
Religionsunterricht ist von „Sünde“ heutzutage eher unter ferner liefen die
Rede. Bei der Eröffnung der Eucharistiefeier wird das Schuldbekenntnis recht
selten genommen. Man bevorzugt andere Formen des Bußaktes. Den Text „Ich habe
gesündigt in Gedanken, Worten und Werken“ versucht man zu umgehen. Will man
ihn der Gemeinde nicht zumuten? Keine andere Sakramenten-Praxis ist so sehr in
die Krise geraten wie die Beichte. Und eine Gemeindereferentin sagte einmal: „Die
Kirche sollte ganz auf das Wort ‚Sünde‘ verzichten, ‚Fehler‘ klingt besser.“
Fallen wir von einem Extrem ins andere?
Doch immer, wenn ein kirchlicher
Sprachgebrauch versandet, sprudeln die Begriffe an anderer Stelle wieder hoch.
So auch das Wort „Sünde“. Es begegnet uns täglich, in profanen, oft
alltäglichen und banalen Zusammenhängen. Zum Beispiel: Jemand will abnehmen,
versucht Diät zu halten, hat sich aber doch ein Stück Kuchen gegönnt und sagt
mit einem entschuldigenden Lächeln: „Heute habe ich wieder einmal gesündigt.“
Die Polizei richtet Radarfallen ein, um „Temposünder“ zu erwischen,
die dann in der vom Volksmund so genannten „Verkehrssünderkartei“
registriert werden. Wer ein Bannkonto in Lichtenstein hat, gerät rasch in den
Verdacht, ein „Steuersünder“ zu sein. Selbst große, nicht gerade für
kirchliche Nähe bekannte Zeitungen benutzen dieses Wort. Ob den Redakteuren klar
ist, dass mit „Sünde“ nicht ein Verstoß gegen Steuergesetze, sondern eine Abkehr
von Gott gemeint ist?
Doch auch wenn Gott erwähnt wird,
ist die Rede oft banal. „Kleine Sünden“, sagt das Sprichwort,
„bestraft der liebe Gott sofort“. Und mancher wird sich noch an den
Karnevalsschlager erinnern: „Wir sind alle kleine Sünderlein, `s war immer
so, `s war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeih‘n, `s war immer,
immer so.“ – Sollte sich die Kirche angesichts dieses Befundes nicht
tatsächlich vom Begriff der Sünde verabschieden?
Nein! Nicht, wenn sie dem
Evangelium treu bleiben will.
Im Gleichnis vom Pharisäer und vom
Zöllner wendet sich Jesus ausdrücklich an jene, „die von ihrer eigenen
Gerechtigkeit überzeugt waren“, die sich auf der sicheren Seite wähnen, die
Umkehr und Vergebung nicht nötig haben, für die Sünde kein Thema ist, weil sie
sich ohnehin zu den Guten rechnen. Er wendet sich an jene, „die andere
verachteten“, die Sünden, wenn überhaupt, nur bei anderen registrieren.
Ihnen stellt Jesus den Zöllner vor
Augen, der sich bewusst ist, dass er Gottes Ansprüchen nicht genügen kann. Der
nicht aus eigener Kraft und Anstrengung vor Gott gerecht sein kann. Der weiß,
dass er ganz und gar auf Gottes Erbarmen angewiesen ist, und der dies vor Gott
auch ausspricht. Und diese Haltung, sagt Jesus, macht ihn gerecht.
Ein tröstliches Evangelium! Gott
verlangt von mir keine religiösen Leistungen. Ich muss kein Superchrist sein,
perfekt und tadellos. Wer sich selbst kennt, sich selbst realistisch einschätzt
und sich nichts vormacht, derjenige, der noch demütig an seine Brust zu klopfen
vermag und sagen kann „Gott sei mir Sünder gnädig“, der ist ihm lieber
als der, der sein Gutsein vor ihm ausbreitet, sich selbst beweihräuchert und auf
andere herabblickt und Schlechtigkeit und Böses immer nur bei anderen sieht.
Bei der Berufung des Zöllners Levi
sagt Jesus: „Ich bin gekommen, um die Sünder zu berufen, nicht die
Gerechten!“ – Das Evangelium sagt mir: Hab Mut, Dich als Sünder vor Gott zu
bekennen. Steh dazu und freu dich! Denn dich will Jesus retten. |